 Die rasant sich verbreitende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Entwicklung gänzlich neuer internetbasierter Geschäftsmodelle und die unübersichtliche Umwälzung sozialer Beziehungen haben innerhalb weniger Jahre ökonomische Verhältnisse hervorgebracht, denen das herkömmliche Steuerrecht hoffnungslos hinterherläuft. In beachtlichem Umfang haben die Internetgiganten (GAFA = Google, Apple, Facebook, Amazon) Wirtschaftsmodelle und Geschäftstätigkeiten kreiert, die sich entweder ganz oder in großen Teilen der staatlichen Besteuerung entziehen, obwohl gerade diese Unternehmen in erheblichem Maße von der ökonomischen, sozialen und technischen Infrastruktur (Einkommen, Bildung, Netze), die die Staaten zur Verfügung stellen, nicht nur partizipieren, sondern sich erst auf dieser Grundlage entwickeln und gedeihen konnten.
Die rasant sich verbreitende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Entwicklung gänzlich neuer internetbasierter Geschäftsmodelle und die unübersichtliche Umwälzung sozialer Beziehungen haben innerhalb weniger Jahre ökonomische Verhältnisse hervorgebracht, denen das herkömmliche Steuerrecht hoffnungslos hinterherläuft. In beachtlichem Umfang haben die Internetgiganten (GAFA = Google, Apple, Facebook, Amazon) Wirtschaftsmodelle und Geschäftstätigkeiten kreiert, die sich entweder ganz oder in großen Teilen der staatlichen Besteuerung entziehen, obwohl gerade diese Unternehmen in erheblichem Maße von der ökonomischen, sozialen und technischen Infrastruktur (Einkommen, Bildung, Netze), die die Staaten zur Verfügung stellen, nicht nur partizipieren, sondern sich erst auf dieser Grundlage entwickeln und gedeihen konnten.
Die alte steuerliche Welt – vor Globalisierung und Digitalisierung – funktionierte so: Ein Unternehmen produziert in einem Land Güter, die Gewinne, die aus den Verkaufserträgen fließen, werden mit einer Unternehmenssteuer, der Körperschaftssteuer, belegt, beim Übergang in die Endkonsumtion fällt für den Kunden bzw. Verbraucher die Umsatzsteuer an. So einfach war die Welt früher. Beim Verkauf ins Ausland wurde die Sache komplizierter, aber dafür hat man Lösungen gefunden. Bei der Herstellung des europäischen Binnenmarktes wurde es dann mitunter strittig, die Frage war, ob nach dem Ursprungsland- oder dem Bestimmungslandprinzip verfahren werden sollte. Die Kommission trachtete danach, einen Binnenmarkt, einen „inländischen“ Markt herzustellen, also setzte sie sich für das Ursprungslandprinzip ein.
Ganz kompliziert wurde es im internationalen Steuerrecht mit der Entstehung und Ausbreitung des Internets, das für Unternehmen Standorte oder Betriebsstätten im herkömmlichen Sinne überflüssig machte, und damit emporkommender neuer kommerzieller Modelle, die in Dreiecksmustern Anbieter und Nutzer auf bislang unbekannte Art zusammenbrachten oder auf der Basis von Big Data Nutzerinformation für Werbezwecke verkauften. Das allerletzte Glied in der Internet-Kette, der Nutzer von Diensten, ließ sich mit geschickten Geschäftsideen einer Verwertung zuführen.
Die Faktenlage zum Thema Besteuerung von Internetdiensten bzw. -unternehmen sieht so aus:
- Die neuen digitalen Unternehmen zahlen weniger als die Hälfte der Steuern von traditionellen Unternehmen. Eine von der Kommission zitierte Studie kommt auf einen effektiven Steuersatz von 23,2 Prozent bei traditionellen Unternehmen und von 9,5 Prozent bei digitalen Unternehmen. Wenn denn die digitalen Unternehmen überhaupt Steuern zahlen. Aus dieser Konstellation ergeben sich gravierende Wettbewerbsvorteile gegenüber traditionellen Unternehmen.
- Die großen Internet-Konzerne haben i.d.R. keinen Sitz in der EU – schon gar keine Produktionsstätte, da nichts im herkömmlichen Sinn produziert wird –, also keine Gebäude, Büros, Mitarbeiter usw., erzielen mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa aber Gewinne. Genau hier liegt die Lücke des alten Steuerrechts: die Körperschaftssteuer ist gebunden an einen Unternehmenssitz.
- Zwei neue digitale Geschäftsmodelle entziehen sich der Besteuerung sehr weitgehend bis ganz: 1.) Unternehmen wie z.B. Facebook und Google, die Giganten des internationalen Werbemarktes, die Nutzerdaten en masse sammeln und Erträge dadurch erzielen, dass sie diese Daten für Werbezwecke verkaufen. 2.) Unternehmen wie z.B. Airbnb oder booking.com, die als Intermediäre fungieren und Nutzergruppen im Netz zusammenbringen und dadurch Erträge erzielen, dass eine der Nutzergruppe Gebühren o.ä. zahlt.
- Im europäischen Binnenmarkt droht in Hinblick auf die Digitalsteuer eine Fragmentierung, da es Mitgliedstaaten gibt, die eine Digitalsteuer bereits eingeführt haben (Italien), Staaten, die kurz davorstehen oder sich stark für eine Digitalsteuer einsetzen (Frankreich, Deutschland usw.) und solchen, die eine Digitalsteuer ablehnen (die üblichen Steuerparadiese: Irland, Luxemburg).
Die Kommission hatte im Herbst 2017 auf Druck einiger Mitgliedstaaten eine Initiative für die Einführung einer Digitalsteuer („Google-Tax“) angekündet und dieser Tage zwei Richtlinienentwürfe vorgelegt, mit denen die Problematik angegangen werden soll. Der eine Richtlinienentwurf befasst sich mit einer langfristigen Lösung und versucht sich an der Überarbeitung des Betriebsstättenkonzepts durch die Einführung einer „digitalen Betriebsstätte“. Die zweite Richtlinie, jene, die für Aufregung in der neoliberalen Öffentlichkeit gesorgt hat, ist als kurzfristige Zwischenlösung gedacht und versucht eine Besteuerung neuartiger digitaler Geschäftstätigkeiten in der EU herbeizuführen, solange es noch keine internationale Lösung gibt. Hier soll es nur um diesen zweiten Entwurf gehen („Richtlinie des Rates zum gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf Erträgen aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen“, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2018:148:FIN).
Die Richtlinie ist ausdrücklich als Zwischen- oder Übergangslösung gedacht, bis man sich im Rahmen der OECD – geplant ist das Jahr 2020 – international geeinigt hat. Die neuen unkonventionellen internetbasierten Geschäftsmodelle folgen nicht mehr der herkömmlichen analogen Kausalität von Betriebsstätte (Wertschöpfung, Produktionsort, Unternehmenssitz) und anschließendem nationalen oder internationalem Verkauf, so dass der Gewinn am Unternehmenssitz und der Umsatz beim Kundenkontakt besteuert werden kann, sondern folgen gänzlich neuen Gegebenheiten.
Zu diesen neuen Gegebenheiten gehören: Unternehmen virtualisieren sich und sind nicht mehr an physische Präsenzen gebunden. „Produkte“ virtualisieren sich gleichfalls, beschleunigen sich gewaltig und werden in Gestalt von Big Data zu ganz neuen Produkten generiert. Und schließlich gerät die gesamte Ökonomie von Kosten und Nutzen, Tauschwert und Gebrauchswert, Anbieter und Nachfrager usw. durcheinander, so dass auf dieser Basis eben die vollständig neuartigen Geschäftsmodelle entstehen.
In der Begründung für die Besteuerung digitaler Unternehmen geht die Kommission davon aus, dass eine Wertschöpfung durch die Nutzer digitaler Dienste – jenseits monetärer Bewertungen – erfolgt.
„Die Digitalsteuer ist eine Steuer mit einem zielgerichteten Geltungsbereich, die auf Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen erhoben wird, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Wertschöpfung durch die Nutzer erfolgt (Herv.d.V.). Bei den Dienstleistungen, die in den Geltungsbereich der Digitalsteuer fallen, stellt die Beteiligung eines Nutzers an einer digitalen Aktivität einen wesentlichen Input für das Unternehmen dar, das diese Aktivität ausführt, und das Unternehmen kann daraus Erträge erwirtschaften.“
Im Richtlinienentwurf benennt die Kommission in „Artikel 3. Steuerbare Erträge“ drei durch einen Rechtsträger, d.h. ein Unternehmen, angebotene Dienstleistungen, mit denen Erträge erwirtschaftet werden, die zu einer Besteuerung führen sollen:
- Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbeflächen,
- Erträge aus der Vermittlung von Nutzern (interaktive Portale), von denen einer ein Entgelt entrichtet,
- Erträge, die aus dem Verkauf von Nutzerdaten erzielt werden.
Nicht betroffen wären Streaming-Dienste und reine Verkaufsplattformen. Steuerpflichtig sollen Unternehmen sein, die a) weltweit mehr als 750 Millionen EUR in einem Geschäftsjahr erzielen und die b) innerhalb der Union mehr als 50 Millionen EUR erzielen. Schätzungen zufolge geht es um etwas mehr als 100 Unternehmen.
Die Digitalsteuer soll 3 Prozent betragen (Artikel 8). Die Steuer erhält der Staat, in dem der jeweilige Nutzer, der den Beginn der Wertschöpfungskette darstellt, seinen Sitz hat. Der Ansatzpunkt sind die Bruttoerträge des Unternehmens minus Mehrwertsteuer u.ä. Es wird geschätzt, dass es um Einnahmen von rund 5 Milliarden EUR geht, also eine eher überschaubare Größe.
Kaum dass der Richtlinienentwurf der Kommission am 21. März 2018 publiziert war, setzte auch das neoliberale Lamento ein. In Kommentaren und Artikeln geriert man sich als Schutzpatron der Internetkonzerne, als Anhänger der Steuersystematik und als Internationalist, der sich für das internationale Steuersystem stark macht. Und über allem schwebt die fundamentale Aversion gegen Steuern überhaupt, insbesondere Unternehmenssteuern, und gegen die Europäische Union, insbesondere wenn sie als EU-Kommission auftritt.
Der Kommission unterstellt man, dass sie mit der angestrebten Digitalsteuer eine Art „Rachesteuer“ gegen die in den USA weitgehend steuerbefreiten Internetunternehmen plane. Das ist die übliche neoliberale Europafeindlichkeit. Dass die Kommission gegen die Fragmentierung des Binnenmarktes vorgehen muss, wird umgedreht, und es wird ihr untergeschoben, dass sie selbst sich neue Einnahmequellen erschließen möchte.
Die Verliebtheit in das alte analoge Besteuerungsprinzip – beim produzierenden Unternehmen werden Körperschaftssteuern erhoben, beim kaufenden Kunden die Umsatzsteuer – ist so ausgeprägt, man weint ihr etliche Tränen hinterher und will das Kommissionskonzept der „Nutzerwertschöpfung“ partout nicht akzeptieren. Die Verliebtheit in das alte System geht sogar so weit, dass man die „Kostenlos-Kultur“ im Internet anfeindet, sie abgeschafft sehen möchte, um dann wieder „normale“ Umsatzsteuern auf die digitalen Dienstleistungen zu erheben. Man will den Geist, der aus der Flasche entfleucht ist, koste es, was es wolle, in die Flasche zurück zwängen.
Auch die Passion für das internationale Steuersystem ist beeindruckend. Die USA haben die Internetgiganten doch nicht von der Steuer freigestellt, um sie Jahre später in OECD-Verhandlungen fremden Steuerordnungen zu unterwerfen, ganz abgesehen von der jüngsten Steuerreform, mit der man die Abtrünnigen zurücklocken will. Wie nur kann man auf die Idee kommen, dass der auf Krawall gebürstete US-Präsident im OECD-Rahmen einer alle Seiten zufriedenstellenden neuen internationalen Steuersystematik 2020 zustimmen wird?
Ganz besonders delikat ist der Hinweis, dass das exportorientierte Deutschland es keinesfalls durchgehen lassen könne, wenn, wie im Kommissionsvorschlag vorgesehen, das Besteuerungsrecht in das Land des Kunden verschoben wird. „Damit droht ein Paradigmenwechsel, der die gegenwärtige Balance der Steuerkompetenzen zugunsten der importierenden Staaten aufhebt“ (Wolfgang Schön, „Der digitale Steuerirrweg“, FAZ, 06. April 2018). Man wird gewahr: Im Welthandelssystem rumort es viel kräftiger und noch an ganz anderen Orten (z.B. bei dauerhaft-erratischen Handelsbilanzüberschüssen), als es die bisherigen protektionistischen Geplänkel zwischen den USA und China ankündigen.
Die Digitalsteuer wird in absehbarer nicht kommen, es wird ihr so ergehen wie der Finanztransaktionssteuer, die irgendwo im europäischen Kanalsystem stecken geblieben ist. Steuerfragen sind Veto-Fragen, sie müssten einstimmig beschlossen werden. Ob eine Lösung wie bei der Finanztransaktionsteuer („verstärkte Zusammenarbeit“) möglich ist, erscheint fraglich. Die bekannten europäischen Steuerparadiese stehen im Wege. Ganz besonders ärgerlich ist das im Falle Irlands. Schon ein Skandal war, dass man Irland im Rahmen des Hilfsprogramms der Eurozone nicht dazu gezwungen hat, steuerpolitisch mehr europäische Kooperationsbereitchaft zu zeigen. Ein fast noch größerer Skandal ist, dass sich Irland nach wie vor weigert, die Steuernachzahlung von Apple in Höhe von 13 Milliarden EUR einzutreiben und weiter auf Obstruktion setzt. Und das in einer Situation, in der das Land im Zusammenhang mit den Brexit-Verhandlungen und noch mehr bei Lösungen oder Nicht-Lösungen in allerhöchster Gefahr steht.

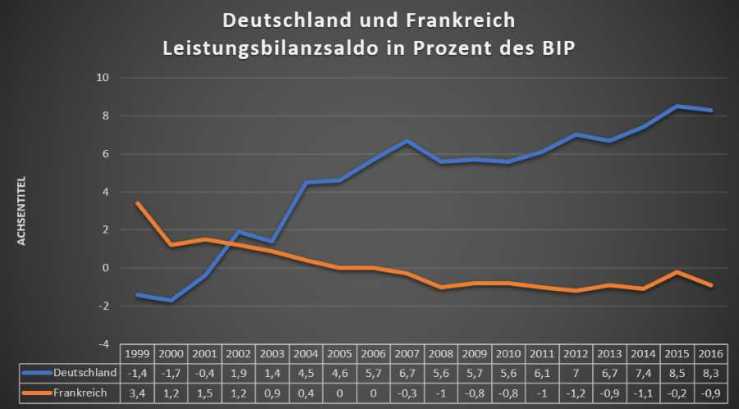

![Unterschrift_des_Koalitionsvertrages_der_18._Wahlperiode_des_Bundestages[1]](https://euroordo.eu/wp-content/uploads/2018/03/unterschrift_des_koalitionsvertrages_der_18-_wahlperiode_des_bundestages1.jpg?w=226&h=175)


![ESM_Logo.svg[1]](https://euroordo.eu/wp-content/uploads/2018/02/esm_logo-svg1.png?w=368&h=133)