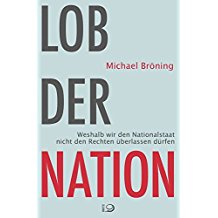In manchen Kreisen der akademischen und politischen Europakritik gehört es seit einigen Jahren zum gepflegten Ton, die Vorbehalte gegen die europäische Integration auf einem Umweg vorzubringen. Den argumentativen Umweg wandert man mit dem Rekurs auf Friedrich August von Hayek, den Ultraliberalen, im Rucksack. Hayek habe in einem kleinen Aufsatz von 1939 („The Economic Conditions of Interstate Federalism“)[1] prophetisch eine schicksalhafte Zukunft für Europa an die Wand gemalt, eine Entwicklung, die ein halbes Jahrhundert später eingesetzt habe. „Hayeks Aufsatz von 1939 liest sich wie ein Konstruktionsplan für die Europäische Union von heute“ (Streeck 2013, S. 146). Und wenn der Ultraliberale die EU quasi erfunden hat, dann bleibt ja nur die schroffe Ablehnung der Europäisierung, so wohl die schlichte Insinuation. Ähnlich wie Wolfgang Streeck argumentiert unter Bezugnahme auf den genannten Aufsatz Quinn Slobodian, der von einer „implizite(n) – und sogar explizite(n) – Inspiration für die wirtschaftliche Integration Europas“ (Slobodian 2020, S. 152) spricht. Das macht so manchen Sozialwissenschaftler erschrocken, z.B. Thomas Biebricher. „Es ist verlockend, die geradezu unheimlichen Analogien (Herv.d.Verf.) zwischen Hayeks Entwurf aus dem Jahr 1939 und der heutigen Eurozone weiterzuverfolgen, erscheint doch Hayeks(s) Föderation geradezu als Bauplan für die Wirtschafts- und Währungsunion“ (Biebricher 2021, S. 99).
Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit dieser Erzählung vom Hayekschen „Konstruktions- und Bauplan“ für Europa, indem sie erstens Hayeks Aufsatz einer präzisen Lektüre, Interpretation und Einbettung unterziehen, und zweitens Hayeks Thesen skizzenhaft an Struktur und Funktionsweise der EU prüfen. Es wird sich zeigen: Es handelt sich um ein Schauermärchen.
Der Aufsatz – eine zeitbedingte „Gelegenheitsarbeit“
Slobodian wundert sich, warum im 34 Kapitel umfassenden „Oxford Handbook of Austrian Economics“ kein einziges Kapitel zu den internationalen Ordnungsvorstellungen der Österreicher enthalten ist. Er wundert sich auch darüber, dass Hayek in einem Interview (1983) einer Weltregierung eine strikte Absage erteilt. Er hätte auch hinzufügen können, dass sich in Hayeks Spätwerk nur wenige bis keine Ausführungen zur europäischen Integration, zur Globalisierung und zum globalen Freihandel finden. Slobodian nennt dies „bewusste Verleugnung“ bzw. „selektiven Gedächtnisverlust“ (Slobodian 2020, S. 133).
Die Antwort auf diesen dem Scheine nach paradoxen Befund ist vor dem Hintergrund von Hayeks Gesamtwerk und der Entwicklungsgeschichte seiner Theoretisierungen zu finden. Wie bei anderen „großen Denkern“ registriert man das Phänomen, dass sie verschiedene Phasen und mitunter gewaltige Metamorphosen durchlaufen haben. Gerade bei Hayek sind diese Metamorphosen (und Weiterentwicklungen sowie Neuorientierungen) sehr ausgeprägt. Es ist bei ihm sinnvoll, drei Phasen zu unterscheiden: 1.) Das Frühwerk wird geprägt durch Konjunkturforschung – ab 1927 war er Leiter des Österreichischen Instituts für Konjunkturforschung –, er beschäftigte sich mit Statistik und konkreten Fragen der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik sowie Geldtheorie, im engeren Sinne also mit ökonomischen Fragestellungen. 2.) In der mittleren Phase, einsetzend in den dreißiger Jahren und veranlasst durch die epochalen Veränderungen in der Weltpolitik, verzeichnet man eine Hinwendung zum Politischen und Ideologischen, auch zum Aktivismus, die ihren Höhepunkt in der 1944 erschienenen Streitschrift „The Road to Serfdom“ fand. Ökonomische Fragen im engeren Sinne interessierten ihn in dieser Zeit schon nicht mehr, sie führten zu einer vollständigen Abkehr von der Ökonomie; Mathematik, Makroökonomie usw. zogen sich seine Verachtung zu. Stattdessen rückten Fragen des Rechts und der Wissensproblematik in den Vordergrund. 3.) Die Themen, die das Spätwerk auszeichnen, zeigen eine Hinwendung zu Sozialphilosophie und Erkenntnistheorie, zu Entwicklungsökonomie und eine Radikalisierung des Marktgedankens, hinzufügen ließen sich die rechtlichen und politischen Theoretisierungen in den beiden Großwerken ( „Die Verfassung der Freiheit“, 1960, und „Recht, Gesetzgebung und Freiheit“, Mitte der siebziger Jahre). Die Phase begann im Verlauf der fünfziger Jahre und schlug – in wachsendem Ausmaß – die Richtung der Fundamentalisierung und des Übergangs ins Irrationale ein.
Hayeks schmaler Aufsatz „The Economic Conditions of Interstate Federation“, auf den so gerne Bezug genommen wird, entstammt dem Jahr 1939, also der mittleren Phase seines Schrifttums. Für den „eigentlichen Hayek“ der Spätphase kann er also nicht herhalten. Aber das ist als Hinweis läppisch. Wichtiger ist, dass sein Inhalt weder mit der 1957 gegründeten EWG und der späteren Währungsunion ab 1992, mit denen sich Streeck auseinandersetzt, noch mit GATT/WTO, Slobodians Themen, etwas zu tun hat, nicht einmal als Muster herhalten kann.
Es ist umgekehrt so, dass Hayeks Haupt- und Spätwerk Anzeichen einer Rückbesinnung auf den Nationalstaat aufweist. Alle Internationalisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg – beginnend mit dem IWF und der Weltbank, sich fortsetzend mit der europäischen Integration und endend mit GATT/WTO – mussten für ihn eine einzige Enttäuschung sein, daher auch sein offensichtliches Desinteresse an diesen Institutionalisierungen. Seine beiden politischen und rechtsphilosophischen Hauptwerke und die zahlreichen Aufsätze beschäftigen sich dann auch nicht mehr mit dem Internationalen, sondern eher dem Nationalen und den nationalen Konstruktionen.
*Das gilt nicht zuletzt für seine Überlegungen zur Zerschlagung des nationalen Geldwesens, nicht internationale Währungsunionen oder nationaler Währungswettbewerb fanden sein Interesse, er begab sich in seinen Überlegungen in das Innere der Marktwirtschaft (und der Demokratie).*
Im Mittelpunkt von Hayeks Überlegungen in der mittleren Phase stand die Frage, wie die ökonomische Macht des Nationalstaates gebrochen werden kann. Nachdem der durch den Goldstandard gestiftete weltwirtschaftliche Funktionszusammenhang im Ersten Weltkrieg untergegangen war, eröffneten sich für die Nationalstaaten neue wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen in das reine Marktgeschehen interveniert werden konnte. Hinzukam, dass sich die Zahl der Nationalstaaten mit dem Zusammenbruch der Imperien und der Entkolonisierung rasant vervielfachte. In den entwickelteren Ländern machten sich keynesianische Vorstellungen über die Steuerung der nationalen Volkswirtschaften breit. Die nicht entwickelten, entkolonisierten Länder begaben sich auf den Weg der nachholenden Entwicklung. Ein ganzer Block von Ländern fiel aus dem weltwirtschaftlichen Kontext vollständig heraus, zunächst die Sowjetunion, nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Länder in Europa und im Rest der Welt.
All dies beunruhigte die liberale Welt zutiefst, und sie begann sich zu formieren, vor dem Zweiten Weltkrieg in Paris im Lippmann-Kolloquium (1939), danach in Genf in der Mont-Pèlerin-Gesellschaft (1947). Hayeks Föderations-Aufsatz hätte, so könnte man glauben, einen inhaltlichen Ansatzpunkt für die neue, jetzt neoliberal genannte Bewegung abgeben können. Und genau diesem Gedanken folgt Slobodian und all die anderen von Hayek Faszinierten (oder Geblendeten). Allein – der Aufsatz war argumentativ viel zu dünn, zu widersprüchlich, zu naiv, als dass er das Programm für ein neoliberales Welt- oder Europaprogramm hätte abgeben können. Er war eben eine „Gelegenheitsarbeit“.
Wer sich die Mühe macht, den Text zu lesen und nicht nur erschrocken die Überschrift zur Kenntnis nimmt, fragt sich, warum sich all die linken Kritiker so von ihm haben einschüchtern lassen und ihm eine Bedeutung zumaßen, die ihm nicht beikam.
Der Inhalt des Aufsatzes
Der Aufsatz gliedert sich in fünf Abschnitte. Im ersten Abschnitt führt Hayek aus, dass die politische Union der Föderation nicht nur eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik, sondern unbedingt auch eine Wirtschaftsunion umfassen sollte: „Es scheint ziemlich sicher, daß eine politische Union zwischen einstmals souveränen Staaten ohne gleichzeitige Wirtschaftsunion nicht lange dauern würde“ (S. 328). Im zweiten Abschnitt skizziert er die Konsequenzen des Wegfalls der Zollmauern und der freien Beweglichkeit von Gütern, Menschen und Kapital für den dann entstehenden einzigen Markt. Dazu zählt er ein einheitliches Geldwesen, ein Zurückgehen der Regulierung einzelner Industrien und die Begrenzung der Staatseinkünfte. In Abschnitt drei setzt er sich mit der Frage auseinander, ob der Bund die bisherigen Planungs- und Lenkungsmaßnahmen der Einzelstaaten übernehmen sollte. Die auftretenden Schwierigkeiten exemplifiziert er am Beispiel der Zölle, grundsätzlich gelte das aber für allen Protektionismus. Der vierte Abschnitt versucht nachzuweisen, dass in einer Föderation/einem Bundesstaat weniger „regiert“ wird, wenn man keine Übereinstimmung erzielt. Lieber keine Gesetzgebung als einzelstaatliche Gesetzgebung sei die „Feuerprobe“ auf die Reife für eine Föderation. Schlupflöcher für dennoch bestehende einzelstaatliche Gesetzgebung sollten dadurch gestopft werden, dass dem Bund eine „negative Macht“ zukommen sollte, solche einzelstaatlichen Vorgehensweisen zu verbieten, ohne dass er sie selbst ausüben könnte. Der Bund habe die Aufgabe, ein „dauerhaftes Rahmenwerk“ zu schaffen, innerhalb dessen die „unpersönlichen Kräfte des Marktes“ möglichst ungehindert walten könnten. Der fünfte und letzte Abschnitt enthält ein allgemeines Plädoyer für den Liberalismus. Die Föderation könne nur dann Erfolg haben, wenn sie von einer „liberalen Wirtschaftsregierung“ angeführt würde, lautet die erste Feststellung. „Die Abschaffung souveräner Nationalstaaten und die Schaffung einer wirksamen internationalen Rechtsordnung sind die notwendige Ergänzung und logische Vollziehung des liberalen Programms“ (S. 341), so die zweite Feststellung.[2]
Im Stil ist der Aufsatz in dem für Hayek typischen aufgeblasenen, selbstgefälligen, blasierten Ton gehalten, im Inhalt eine Aneinanderreihung von Aussagen, Hypothesen, Vermutungen und Spekulationen, Hoffnungen und Wunschvorstellungen. Im Schlussabsatz rekapituliert er, dass es sich bei der Föderation um eine „Hoffnung“, ein „Ideal“ handelt. Von einer immanenten Logik, die von der Gründung der Föderation über den neuen Binnenmarkt (Wegfall der Zölle und anderer Protektionismen) zur „Abschaffung souveräner Nationalstaaten“ und einer internationalen liberalen Ordnung führt, ist die „Argumentation“ meilenweit entfernt.
Der Begriff der Föderation wird in Hayeks Aufsatz zwar nicht en Detail ausgefaltet, soviel aber ist erkennbar: Er enthielt auf jeden Fall – anders als bei einem bloßen Staatenbund – eine Zentralinstanz, auf die die zentralen Geschäfte der früheren souveränen Nationalstaaten übergehen sollten. Hayek spricht von einer gemeinsamen oder zentralen oder einer föderalen Regierung („common government“, S. 255, „central government“, S. 265, „federal government“, S. 261, S. 267), auch einer Unionsregierung („Union government“, S. 256). Von dem Gebilde spricht er als einer Union (durchgehend im Wechsel mit Föderation) bzw. zwischenstaatlichen Föderation (so im Titel), einer suprastaatlichen Organisation („suprastate organization“, S. 265 f.) bzw. einer internationalen Organisation („international organization“, S. 272).[3]
Die föderale Regierung sollte eine gemeinsame Geldpolitik und Fiskalpolitik (S. 259 f.) und die gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik betreiben (S. 256 f.). Es sollte durchaus eine machtvolle Regierung sein, der auch, wie oben bereits angedeutet, ein Verbotsrecht für legislative Maßnahmen der Einzelstaaten zukommen sollte (S. 267).[4]
Interessant ist, dass Hayek offensichtlich von einem initiatorischen politischen Gründungs- oder Schöpfungsakt ausging, da er im ersten Teil des Aufsatzes ausführlich die Notwendigkeit der Ausdehnung der politischen Union auf das Gebiet der Wirtschaft, im heutigen Sprachgebrauch eine Wirtschaftsunion, begründet. Das Gebilde sollte weder eine Union noch ein Staatenbund, sondern ein Bundesstaat sein (S. 270), wohl am ähnlichsten der Doppelmonarchie, in die er hinein geboren wurde (S. 256). Insgesamt bleiben die Ausführungen dazu eher schemenhaft.
Ziel, Sinn und Zweck der Föderation: Marktmechanismus und Preisbildung sollten sich auf ihrem Territorium möglichst „rein“ entfalten können, d.h. ungestört durch Zölle, Subventionen und andere protektionistische Maßnahmen wie, modern ausgedrückt, Industriepolitik. Innerhalb des föderalen Binnenmarktes wäre der freie Fluss von Arbeit, Gütern und Kapital eine Grundvoraussetzung. Die gegebene und die sich ergebende Arbeitsteilung sollte allein aus dem Marktmechanismus resultieren und nicht durch politische Maßnahmen beeinflusst werden.
Das mit Abstand gewaltigste Hindernis auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels stelle, so Hayek, der Nationalstaat dar. Dieser Aspekt ist in verschiedener Hinsicht von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Neoliberalismus allgemein und speziell für Hayeks Föderationsüberlegungen. Unter historischem Blickwinkel war der Internationalismus aus der Ära des Goldstandards – die Idealwelt für die Regulierung der internationalen Arbeitsteilung – mit dem Ersten Weltkrieg untergegangen und so nach seiner Auffassung nicht wieder herstellbar. Aus diesem Epochenbruch gingen zum Leidwesen der Liberalen all die Nationenbildungen der Entkolonisierung, die Planungsgedanken in den entwickelteren Staaten und die Ansprüche auf nachholende Industrialisierung und industrielle Protektion in den weniger entwickelten Staaten hervor. Der in Hayeks Schrift aus dem Jahr 1939 ausgerufene Gedanke der Relativierung, Eindämmung, gar Zerstörung des nationalen Gedankens fand seinen Ausgangspunkt nicht nur dann, wenn voller Sehnsucht auf das 19. Jahrhundert zurückgeblickt wurde, sondern – positiv – auch in den Erfahrungen in der Doppelmonarchie, in der sie eine Trennung von Wirtschaftlichem (und Politischem) auf der föderalen Ebene und Kulturellem in den nationalen Untereinheiten wahrnahmen.
Die Beseitigung der wirtschaftlichen Grenzen in der und durch die Föderation wäre in der Lage, so der Gedanke, den Nationalismus und seinen Souveränitätsanspruch im Kern zu relativieren und zu überwinden. Der Nationalstaat und der Nationalismus, so Hayek, stehen für Gruppensolidarität und Einzelinteressen (S. 257), für Nationalstolz (des Arbeiters auf „seine“ Industrien) und nationale Stärke (S. 262), für Vorstellungen von Homogenität, gemeinsame Überzeugungen, Werte, Traditionen und nationale Mythen (S. 264). All diese Verwerflichkeiten des Nationalstaates ließen sich in einer Föderation brechen, sie verlören ihre Grundlage und würden im Keim erstickt. Gruppeninteressen, sei es von Industrien, Berufsverbänden oder ganzen Staaten, wären nicht mehr artikulierbar, da sie in einem größeren Ganzen aufgehoben wären. In der Föderation, so deutet es sich im Text an, würden Nationen in Staaten transformiert.
Hayek exemplifiziert den Gedanken am Beispiel der Zollpolitik in einer Föderation (S. 261 ff.) Er fragt: Ist es wahrscheinlich, dass der französische Bauer mehr für sein Düngemittel bezahlen will, um dem britischen Düngemittelproduzenten zu helfen? Würde der schwedische Arbeiter mehr für seine Orangen bezahlen wollen, um den kalifornischen Pflanzer zu unterstützen? Oder der kaufmännische Angestellte in London mehr für seine Schuhe oder sein Fahrrad mehr bezahlen wollen, um den amerikanischen oder belgischen Arbeitern zu helfen? Oder wäre der südafrikamische Bergarbeiter bereit, mehr für seine Sardinen zu zahlen, um den norwegischen Fischern zu helfen? Die genannten Herkunftsländer waren wohl als potentielle Mitglieder einer Föderation gedacht. Durch das Eigeninteresse verschwänden die Zollmauern im Inneren der Föderation, und ähnlich erginge es allen anderen Formen des Protektionismus. Wozu dann aber, so wäre zu fragen, eine Föderation gründen, es genügte doch weit unterschwelliger zu verfahren und eine Zollunion wie die EWG auf den Weg zu bringen?[5] Und weiter wäre zu fragen: Was ist mit dem Außenzoll?
Kritik: Ein wildes Gemisch von Spekulationen
Hayek unterliefen zwei Fehler: 1.) Er ging an keiner Stelle seines Textes auf die Frage ein, warum die Nationalstaaten bereit sein sollten, sich in zwischenstaatliche Föderationen zu begeben, in der sie doch in ihren politischen und wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten beschnitten werden sollten. 2.) Damit zusammenhängend hatte er die Kraft der Nationalstaaten und ihres Souveränitätsanspruchs völlig unterschätzt, ein Aspekt, der ihn später zu der Hinwendung der nationalen Basis der Marktwirtschaft brachte.
Die Auseinandersetzung mit politischen Realitäten gehörte nicht zu Hayeks Stärken. Auch fehlten ihm Bereitschaft und Wille dazu, sich damit zu beschäftigen. Mit den in seiner Lebensphase bestimmenden weltpolitischen Phänomen, dem Aufstieg und Niedergang des Faschismus und dem Kalten Krieg, setzte er sich nicht oder nur am Rande auseinander. Seine Themen lagen auf einer ganz anderen Ebene. Auch tauchen in seinem Aufsatz konkrete und anzustrebende Föderationen nur en passent auf. Am Ende seines Buches „Der Weg zur Knechtschaft“ findet sich folgender Hinweis: „Ich glaube, … daß ein Grad von Kooperation (Herv.d.Verf.) zwischen, sagen wir, dem Britischen Reich und den westeuropäischen Staaten und vermutlich (sic!) den Vereinigten Staaten von Amerika verwirklicht werden könnte“ (Hayek 1945, S. 292). Von Föderation war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr die Rede, es wäre auch ein geradezu abwegig-tollkühner Gedanke gewesen. In dem einige Jahre älteren Interstate-Federation-Text fehlen konkrete Hinweise auf denkbare Föderationen der Zukunft ganz.[6] Er nennt lediglich das British Empire, die USA, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn und die Schweiz als existierende Föderationen.
Auf eine Frage, eine nicht ganz unwesentliche, geht Hayek in seinem Aufsatz nicht ein, nämlich die Frage, warum die Nationalstaaten, den Schritt in die Föderation wagen sollten, warum sie ihre Selbstentmachtung hinnehmen sollten, warum sie sich sehenden Auges einer neuen, über ihnen schwebenden Macht der föderalen Regierung, ihre bisherigen Kompetenzen überlassen sollten. Die Frage nach dem staatspolitischen Motiv zum Übergang in die Föderation bleibt bei Hayek außen vor.
Bekanntlich lebt der Nationalgedanke, wie Hayek selbst hervorhebt, von Mythen, Ideologien und wirklichen oder eingebildeten Gemeinsamkeiten, Phänomen, die nicht einfach zu überwinden sind und sich in politischen Schöpfungsakten nicht einfach beiseiteschieben lassen, die Beharrungskräfte sind groß. Dem Nationalpolitiker oder Politiker in der Nation ist nichts so wichtig, um es tautologisch zu formulieren, wie die Nation, zumal in Demokratien die Legitimation daran hängt. Warum also sollte es geschehen, dass sich Nationen in Staaten verwandeln, sich verflüchtigen und selbst aufheben?
Slobodian äußert sich in seiner Monographie zu diesem Thema gar nicht, Streeck, der sich ausführlicher mit Hayeks Text beschäftigt, hat dazu eine Idee (Streeck 2013, S. 141 ff.). Es gehe dem Österreicher – dem Zeitkontext folgend – um die Bedingungen einer stabilen internationalen Friedensordnung, die nötigte die Nationen in eine Föderation, die nach innen schlichtend wirke und nach außen Sicherheit verschaffe.[7] Es kann bezweifelt werden, dass solche „Externalitäten“ in Hayeks Gedanken eine Rolle spielten, es sei dahingestellt. Den Gründungsakt der Föderation jedenfalls stellte sich Hayek offensichtlich einfach vor, sein argumentatives Hauptinteresse galt der Begründung der Notwendigkeit, dass eine Politische Union unbedingt eine Wirtschaftsunion nach sich ziehen sollte und dass die Föderation wirtschaftliche Liberalisierungen in Gang setzen könnte.
Was Hayeks Aufsatz auf jeden Fall nicht ist, ist eine systematische Überlegung zu einer internationalen Föderation. Es handelt sich vielmehr um ein Sammelsurium von Hypothesen, Annahmen und Vermutungen, um Setzungen unterschiedlicher Plausibilität. Eine schlüssige „Theorie der internationalen Föderation“ stellen die Überlegungen nicht dar. Genau davon geht aber Streeck aus, wenn er auf der Basis von Hayeks Aufsatz formuliert: „Föderation bedeutet .. unvermeidlich Liberalisierung“ (Streeck 2013, S. 144), und er behauptet, dass eine internationale Föderation „notwendigerweise wirtschaftspolitisch liberal sein muss“ (ebd., S. 145). Föderalismus und Föderation – im Sinne von Macht- und Interessenteilung – passen zwar eher in neoliberale Vorstellungswelten und lassen sich in ihrem Sinne ausnutzen, aber es gibt keine inhärente Logik, die föderale Gebilde „unvermeidlich“ und „notwendigerweise“ zu liberalen Gebilden machen.[8] Streecks Problem ist, dass er eine Idee mit einer Logik verwechselt – was passieren kann.
Die EU als Emanation des Hayekschen Föderationsplans?
Nichts von dem, was sich Hayek 1939 zu einer „Interstate Federation“ ausmalte, hat sich 1957 (EWGV) und/oder 1992 (Vertrag von Maastricht) verwirklicht, ganz zu schweigen von IWF, NATO oder anderen internationalen Institutionalisierungen. Daher nimmt es auch kein Wunder, dass er sich in seiner dritten und letzten Lebensphase, wie eingangs erwähnt, anderen Themen zuwandte. Die Richtung, in die sich seine Gedankenwelt bewegte, kehrte sich um, weg vom Internationalen hin zu Grundfragen der Marktwirtschaft (auf nationaler Basis), der Verfassung politischer und rechtlicher Gemeinwesen und die Sozialphilosophie. Die europäische Integration und die globalen Institutionalisierungen strafte er mit Nichtbeachtung, dabei hätte doch, folgt man den Thesen seiner Deuter, aller Grund zum Jubel bestanden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schien der Nationalstaat in Europa bis in seine Grundfesten diskreditiert, in Deutschland war es die rassistische Variante des Nationalismus, im Rest Europas die Schwäche im Kriegsverlauf. Die frühen Europäer knüpften ihre Hoffnungen daran und setzten den Einstieg in eine sofortige politische Vereinigung Europas auf ihre Agenda. Der Schwung hielt aber nicht lange. Mit der Gründung der Montanunion, die mit der Hohen Behörde über eine machtvolle supranationale Institution verfügte, war davon zwar noch etwas zu erahnen, die wenige Jahre später verabredete EWG schwächte schon wieder das supranationale Prinzip, indem nicht die Kommission das Entscheidungsorgan der Gemeinschaft wurde, sondern der nationalstaatliche Ministerrat. Insgesamt war diese Art von Wirtschaftsunion meilenweit von der Hayekschen Föderation aus dem Jahr 1939 entfernt. Und der Nationalstaat wurde in der „Föderation“ EWG nicht geschwächt und in einer föderalen Überwölbung eingedämmt. Die historische Forschung hat das Gegenteil bewiesen, die „Föderation“ EWG trug zur Festigung des Nationalstaates bei (Milward 1992).
Im Kern war die EWG eine Zollunion, nicht mehr. Man muss sich an Hayeks Kerngedanken in seinem Aufsatz erinnern: Eine Föderation sollte durch einen politischen Schöpfungsakt gegründet werden, um die Zölle und alle die anderen verhassten Protektionismen zum Verschwinden zu bringen, ein in gewisser Weise deduktionistischer Gedanke. Wir erinnern uns an die kapriziösen Überlegungen zum kalifornischen Orangenpflanzer und den schwedischen Arbeiter, die sich mit ihren Interessen im Wege stünden, wenn erst einmal die Föderation gegründet ist. In den fünfziger Jahren bedurfte es in Westeuropa keiner Föderation, um die Zölle in der Gemeinschaft abzuschaffen. An dieser Stelle – und an vielen anderen – zeigt sich, wie abwegig und realitätsfern Hayeks Überlegungen waren. Wiedererstarkte Nationalstaaten verständigten sich auf dem begrenzten Gebiet der Handelsliberalisierung, ganz ohne Föderation.
Und die heutige EU? Finden sich in ihr – wenigstens – Spurenelemente der Hayekschen Gedankenwelt, die es rechtfertigen, dass von einer den Nationalstaat domestizierenden politisch-ökonomischen Ordnung gesprochen werden kann? Oder kommt sie einer „hayekschen Wirtschaftsverfassung“ (Streeck 2014) gleich? Von nichts davon kann die Rede sein. Ein über den Nationalstaaten kreisendes Hayekianischen schwarzes Loch, das sie unwiderstehlich aufsaugt und sie zu bloßen Staaten herabsetzt, existiert nur in den vom Meister berauschten Köpfen der Europakritiker. Es sind die in den Räten, dem großen und dem kleinen, zusammenkommenden Nationalstaaten, die die Geschicke des europäischen Projekts steuern. Der Europäische Rat als Kapitän auf dem Schiff lässt die Kommission gewähren (oder auch nicht), er stattet sie mit Aufträgen aus und gibt die Navigation des Schiffes aus. Von einer Zentralregierung der Föderation, wie Hayek sie vorschlug, ist selbst mit Ferngläsern nichts zu sehen. Und im Übrigen: Die Nationalstaaten können in der „Union“ ihre eigene Suppe kochen (die Iren mit ihrer Dumping-Steuerpolitik), setzen ihre eigenen Interessen durch (die Deutschen für ihre Autoindustrie) und können im Zweifelsfall austreten (die Briten) usw. usf.
Und die „hayeksche Wirtschaftsverfassung“? Sofern damit die Währungsunion ohne Wirtschaftsunion, die Regeln und die sonstigen supranationalen „Gesetze“ gemeint sind, haben die Krisen der vergangenen Jahre gezeigt, dass der Traum der Hayekianer und die Vermutung der Europakritiker, ein auf basalen Regeln und Mechanismen beruhender Druck könne die Nationalstaaten disziplinieren, nicht Wirklichkeit geworden ist. Sowohl auf „föderaler“ wie auf nationaler Ebene wurde in den Marktprozess interveniert, was das Zeug hielt.
Der Kerngedanke von Hayeks Föderationsplan war, durch die Staatsbildung auf höherer Ebene die Preisbildung in der größtmöglichen „Reinheit“ zur Geltung zu bringen. Am Beispiel der Preisbildung auf dem Markt für den Staatskredit zeigte sich in und nach der Finanzkrise, dass die europäischen Akteure nicht gewillt waren, die sich plötzlich entwickelnden Marktgegebenheiten hinzunehmen. Neue Institutionalisierungen (ESM) und neuartige Interventionen (EZB) sorgten dafür, dass der differenzierte Zins auf den Staatskredit für die europäischen Staaten eingehegt wurde. Er besteht zwar auf dem eingehegten Niveau weiter, die sich abzeichnende Entwicklung aber ist klar: in der längeren Frist wird es zu einem einheitlichen Zins auf den europäischen Staatskredit kommen, ob in Gestalt von Eurobonds oder auf anderem Weg.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist aber eine Konzession einzuräumen. Es gab im ersten Jahrzehnt der Währungsunion tatsächlich Versuche, Hayekianisches Gedankengut in die Währungsunion zu importieren, allerdings nicht solches aus dem Aufsatz von 1939. Die Idee des in der Währungsunion organisierten Staatenwettbewerbs machte die Runde (vgl. dazu Polster 2022, S. 109 ff.). In Hayeks Aufsatz zur Föderation tauchte dieser Gedanke nur ganz am Rande auf, sozusagen unter ferner liefen (S. 268). Der von deutschen „Hayekianern“ ins Spiel gebrachte Versuch, der von der Merkel-Regierung willfährig aufgegriffen wurde, ist aber kläglich gescheitert. Staatenwettbewerb hatten die Mitgliedstaaten der Währungsunion auf den Währungsmärkten schon vor Maastricht, den föderalen Wettbewerb in der Währungsunion wollten sie sich nicht wieder antun. Das Projekt verschwand in der Versenkung, seither ist nur noch von Europa als Ganzem die Rede.
In der Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zwar zu einigen Internationalisierungen, die waren aber weit entfernt von Hayeks Föderationsplan aus dem Jahr 1939. Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Frage, wie mit dem Kapitalverkehr umgegangen wurde. Sowohl die IWF-Ordnung wie auch der EWGV sahen in dieser Hinsicht strikte Kontrollen vor, um eine souveräne Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten zu ermöglichen, was eine herbe Enttäuschung für die auf dem Lippmann-Kolloquium und wenige Jahre später am Mont Pèlerin zusammengekommen liberalen Geister sein musste. Die m.o.w. verrenkten Überlegungen Hayeks zu einer Föderation, um die Nationalstaaten gewissermaßen auszutricksen, ihre Souveränität zu unterwandern und aus Nationen subordinierte Staaten zu machen, waren auch nicht vonnöten, um die internationale Ordnung in ihrem Sinne zu transformieren. Es genügte der Ansatz an der Regulation des Kapitalverkehrs. Es waren einzelne Nationalstaaten – zunächst Westdeutschland, dann die USA und andere –, die in das dichte Gewebe des kontrollierten Kapitalverkehrs Löcher schossen und nach und nach die Regel des ungehinderten freien Kapitalverkehrs etablierten. Aus der Welt der Nationalstaaten, zu der so manche Europakritiker zurückwollen, kam der Impuls für den Umbau der internationalen Ordnung, ganz ohne Föderation.
Fazit
Hayek kam in seiner späteren Lebensphase wohl selbst zu der Einsicht, dass die politischen Überlegungen zur Gründung einer Föderation aus dem Jahr 1939 untauglich waren, um dem Liberalismus auf internationaler Ebene zum Durchbruch zu verhelfen. In der Konsequenz wandte er sich daher, wie angedeutet, Fragen zu, die in gewisser Weise auf nationaler Ebene angesiedelt sind, zu schweigen von den sozialphilosophischen Überlegungen. Zwei Komplexe seien herausgegriffen: 1.) Politiktheoretisch beschäftigte er sich mit der Frage, wie die (nationale) Demokratie eingeschränkt werden könnte, da sie die größte Gefahr für das autonome Marktsystem darstelle. Das Ergebnis war eine Art Ständedemokratie, „Demarchie“ genannt. 2.) Ökonomietheoretisch verfeinerte, fundamentalisierte und verlängerte er den Wettbewerbsgedanken auf das Geldwesen (1974). Die Entnationalisierung des Geldes via private Gelder emittierender Banken lautete sein Vorschlag, nicht staatlicher Währungswettbewerb oder eine die Nationalstaaten unterjochende Währungsunion. Die Zerschlagung des nationalen Geldwesens, nicht internationale Währungsunionen oder nationaler Währungswettbewerb fanden sein Interesse, er begab sich in seinen Überlegungen in das Innere der Marktwirtschaft (und der Demokratie, die er nicht als Wert fasste und oft genug als Hindernis für die freie Entfaltung der Marktmechanismen wahrnahm).
Hayeks Aufsatz, den die von ihm Berauschten zu einem Modell hochstilisieren, wird maßlos überschätzt, enthält verquere Gedankengänge und landete letztlich in einer Sackgasse. Die Realität ist vollständig an ihm vorbeigegangen. Der Nationalstaat muss nicht durch eine Föderation gebändigt werden, um die Liberalisierung durchzusetzen, das erledigen die Nationalstaaten schon selbst. Es verhält sich gerade umgekehrt so: Wenn die Nationalstaaten nicht in übergeordnete Bündnisse eingebunden werden, die sie zu Mäßigungen, Kompromissen und Eingeständnissen zwingen, entwickeln sie aus sich heraus Alleingänge, „First“-Strategien und Wettbewerbsphantasien im Sinne des Liberalismus, da sie in ihrem Ausgangspunkt – der Priorisierung des Eigenen – Brüder im Geiste sind. Die „Liberalisierungsmaschine Europa“ (Streeck 2014a) ist ein Hirngespinst. Gäbe es Europäisierung und europäische Einigung nicht, hätten ungezügelte liberale Nationalstaaten noch ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten.
In Hayeks „Knechtschaft“-Kampfschrift findet sich eine schöne Metapher, die als Desiderat seiner Gedankengänge zum Föderalismus gelten kann: Die „übernationale Instanz“ habe die Aufgabe, die Staaten von „Regisseuren“ in „Darsteller“ zu verwandeln (Hayek 1945/1991, S. 286). Auf die EU transponiert ließe sich der Unsinn von dem Föderalismus als Liberalisierungsmaschine nicht besser zum Ausdruck bringen: Die „Regisseure“ des europäischen Projekts sind die Nationalstaaten, die „Darsteller“ sind die europäischen Institutionen, ihre Repräsentanten und die ideologischen Bannerträger. Wer das europäische Theater nicht von innen kennt, sollte sich dazu nicht äußern.[9]
Slobodian ist so schlau, dass er die EU nicht expressis verbis als Emanation der Hayekschen Föderationsüberlegungen benennt. Er zitiert nur den Vertreter der These (Streeck). Er ist auch so schlau, nicht en Detail auf den Aufsatz einzugehen, er hält sich an die Überschrift und leitet daraus einen obskuren „Ordoglobalismus“ ab (S. 148 ff.). Ansonsten liest er in den Aufsatz Dinge hinein, wahlweise auch heraus, die nicht ihm stehen.[10]
Das Schauermärchen von der Angst einflößenden Hayekianischen Föderation, die in der EU wiederkehrt – es ist nur ein Schauermärchen, das von Sozialwissenschaftlern erfunden und erzählt wird, um Gruseln zu erregen. Weder zu Ehrfurcht (Hayek als Seher) noch zu Angst (um Europa oder den Nationalstaat) besteht Anlass. Das unter nationalstaatlicher Ägide funktionierende Europa entwickelt sich nach anderen Logiken und Gesetzmäßigkeiten, als es Hayek in seinem Aufsatz für eine fiktive Föderation entworfen hatte.
Literatur
Biebricher, Thomas 2021: Die politische Theorie des Neoliberalismus, Bonn.
Hayek, Friedrich August von 1939: The Economic Conditions of Interstate Federalism. In: Ders., Individualism and Economic Order, Chicago und London 1948/1980.
Hayek, Friedrich August von 1945/1991: Der Weg zur Knechtschaft, München.
Hayek, Friedrich August von 1976: Die wirtschaftlichen Voraussetzungen föderativer Zusammenschlüsse. In: Ders., Individualismus und wirtschaftliche Ordnung, Salzburg.
Milward, Alan S. 1984/1992: The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London.
Polster, Werner 2022: Die Herausbildung einer europäischen Wirtschaftspolitik. Wirtschaftsregierung, Zahlungsbilanz und wirtschaftspolitische Koordination, Marburg.
Slobodian, Quinn 2020: Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus, Berlin (2. Auflage).
Streeck, Wolfgang 2013: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Bonn.
Streeck, Wolfgang 2014a: Liberalisierungsmaschine Europa. Interview in Carta vom 6. Januar.
Streeck, Wolfgang 2014b: Small State nostalgia? The currency union, Germany, and Europe: A reply to Jürgen Habermas. In: Constellations 21/2.
[1] Der Aufsatz erschien erstmalig im September 1939 in der Zeitschrift „New Commonwealth Quarterly“, V, No 2. Er wurde neu aufgelegt in Hayeks Sammelband „Individualism and Economic Order“ aus dem Jahr 1948 (Chicago) und in einer weiteren Auflage desselben Bandes (Chicago und London 1980). Von diesem Sammelband gibt es zwei deutsche Übersetzungen, eine ältere aus dem Jahr 1952 (Erlenbach-Zürich) und eine neuere aus dem Jahr 1976 (Salzburg), beide nur noch antiquarisch erhältlich. Eine Art Kondensat des Aufsatzes findet sich am Schluss von Hayeks „Knechtschaft“-Buch. Im Vorwort der zweiten deutschen Ausgabe misst Hayek dem Aufsatz zwar nach wie vor „Bedeutung“ zu, qualifiziert ihn aber als den zeitlichen Umständen von 1939 folgende „Gelegenheitsarbeit“.
[2] Die Zitate in diesem Absatz sind der zweiten deutschen Auflage von 1976 entnommen.
[3] Die Seitenangaben beziehen sich hier auf die englische Fassung von 1980. In der deutschen Übersetzung wird meist von einem „Bundesstaat“ gesprochen, nicht von „Föderation“.
[4] Bei Hayek-Interpreten und -Deutern geht der Charakter der Föderation als starkem, machtvollen Gebilde mit einer ebenso ausgestatteten Regierung gänzlich verloren. Slobodian unterschlägt diesen Aspekt vollständig und spricht stattdessen von einer „lockeren Föderation“ (Slobodian 2020, S. 149) und reduziert sie auf eine „Freihandelsföderation“ (ebd., S. 148). Das passt natürlich besser zu der späteren Freihandelsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, in der sich angeblich die Neoliberalen verwirklichten. Wir haben dagegen gesehen, dass das Gegenteil der Fall ist: Die Föderation stellte bei Hayek ein machtvolles staatliches Gebilde dar. Dass es sich bei dieser Föderation – wie bei Mises (s.u.) – um eine recht freihändig hergestellte Konstruktion handelte und einen Abweg in die mit Luftschlössern verbaute Welt wilder Spekulationen handelte, steht auf einem anderen Blatt.
[5] Im „Weg zur Knechtschaft“ führt er aus: „In Wirklichkeit liegt einer der Vorzüge der Föderation in der Möglichkeit, sie so zu konstruieren, daß die meisten schädlichen Maßnahmen der Planung erschwert werden, während der Weg für alle wünschenswerte Planung offenbleibt“ (Hayek 1945, S. 288).
[6] Die Vertreter der „Genfer Schule“ (Slobodian 2019, S. 16 ff.) hatten ihre Wiege in der KuK-Monarchie Österreich-Ungarn, einer Föderation. Einen Hinweis auf die Politikfremdheit der Österreicher bzw. Genfer findet man bei Hayeks Weggefährten Ludwig von Mises, der sich auch seine Gedanken zu Föderationen machte. Die Doppelmonarchie galt ihm (und andeutungsweise auch Hayek) als ein Modell für die zukünftige internationale Ordnung, da sie auf der Trennung von Staat und Nation beruhte und in ihr die nationale Souveränität, das Hauptproblem nach dem Ersten Weltkrieg, relativiert und begrenzt werde. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1941 schlug Mises als Konkretion des Föderationsgedankens eine „Demokratische Union Osteuropa“ („Eastern democratic union“) vor, die ein Gebiet von der Ostsee über die Adria und die Ägäis bis zum Schwarzen Meer und von der Ostgrenze der Schweiz und Italiens bis zur Westgrenze Russlands umspannen sollte (Slobodian 2019, S. 151 ff., insb. S. 159 f.).
[7] Hayeks Loblied auf die friedensstiftende Wirkung der Föderation ist naiv und geschichtsblind. Es lassen sich haufenweise Beispiele anführen, die auf innere Instabilitäten von Föderationen (US-Bürgerkrieg) und äußere Aggressionen (die Doppelmonarchie vor dem Ersten Weltkrieg) deuten. Begreift man das britische Empire als Föderation (und all die anderen Kolonialmächte), dann kann von friedensstiftender Wirkung schon überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Beispiele für die innere Instabilität von Föderationen aus der jüngeren Geschichte: die sich abzeichnende Auflösung der Großbritanniens, einschlägige Tendenzen in den USA, die Auflösung der Tschechoslowakei, der Zerfall Jugoslawiens.
[8] Das föderale Gebilde USA schaffte es in der Vergangenheit und der Gegenwart immer, sich im Innern und nach außen hin mit den dunklen Mächten (Hayek: „powers of darkness“, S. 266) zu verbünden und Regulationen im Inneren und Protektionismus nach außen zu praktizieren. Das föderale Gebilde Bundesrepublik Deutschland wiederum lässt für den „Preis der Arbeit“ nicht zu, dass Preisbildung nach „einzelstaatlichen“ oder regionalen Gegebenheiten erfolgt, sondern kennt Tariflöhne, allgemeine Renten und sonstige Sozialleistungen.
[9] Streecks Vorschlag eines Zurück zum Nationalstaat (Streeck 2013, S. 246 ff.) wäre ein tautologisches Vorhaben. Dass es um mehr geht als die Auflösung der Währungsunion und die Wiedereroberung eines wirtschaftspolitischen Instruments, der Abwertungspolitik, zeigt sich in seiner Romantisierung des Nationalstaats. Die Nation gilt ihm als „eigen-artige wirtschaftliche Lebens- und Schicksalsgemeinschaft“ (ebd., S. 247). „Lebens- und Schicksalsgemeinschaft“ – das kennt man doch irgendwoher.
[10] Slobodians ansonsten sehr lesenswerte Analyse setzt sich mit der Entstehung, Entwicklung und dem Einfluss der neoliberalen Ideologie und ihrem Widerhall in der Globalisierung des 20. Jahrhunderts auseinander. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es sich bei ebendiesem Jahrhundert um das „neoliberale Jahrhundert“ handele (Slobodian 2020, S. 376). Einmal abgesehen davon, dass man mit mindestens dem gleichen Recht vom „Jahrhundert des Keynesianismus“ sprechen könnte, muss die Qualifizierung doch erstaunen. Das institutionelle Resultat, so seine These, für die neoliberale Gestaltung des 20. Jahrhunderts war die 1995 gegründete WTO, an und in der Hayekianer fleißig mitwirkten (ebd., S. 343 ff.). Ihre Blütezeit war aber schon 1999 wieder vorbei, als in Seattle ihre Gegner und Kritiker zusammenkamen und eine Tagung verhinderten (ebd., S. 389 ff.). Heutzutage blickt man, wenn man die WTO in Augenschein nimmt, auf eine Ruinenlandschaft.